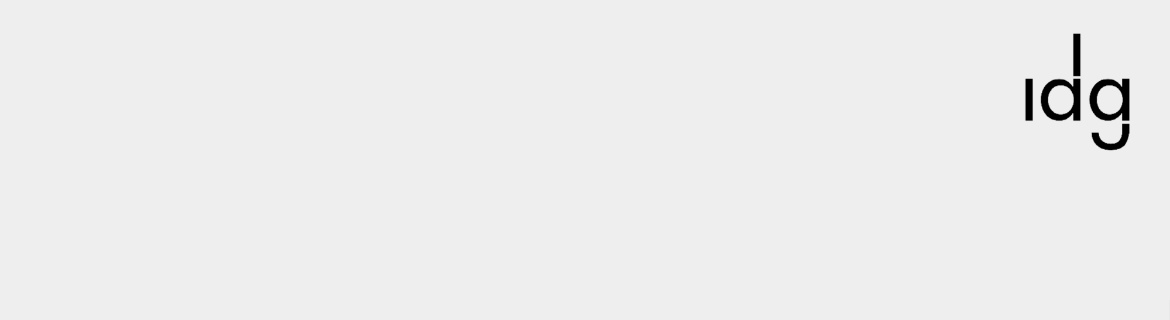
Sommersemester 2025
Das IDG setzt mit diesem Seminar die Beschäftigung mit reduziertem Raum als thematische und gestalterische Untersuchung in Bezug auf das Thema „Nachhaltigkeit und Bauwende“ fort. Hierbei geht es um die Frage der Materialreduzierung wie auch um die sparsamere Verwendung von Raum.
Der Begriff „Monocoque“ bezieht sich unter anderem auf die Schalenbauweise von Fahrzeug-Kabinen für den Menschen. Die Größen-Ökonomie dieser Räume wird im Hinblick auf den nötigen Umraum (des Menschen) als auch in Bezug auf den Anschluss an seine Umgebung/ -en untersucht.
Die Kleinsträume richten sich hierbei auf die räumlichen Bedürfnisse des Menschen und beziehen diese als Ausgangspunkte ein. Die Positionierung und die Formulierung des Anschlusses an einen Bestandskontext (zunächst Wand/ Boden/ Decke; ggf. konstruktive Strukturen) sind hierbei außerdem gestalterisch auszuformulieren.
Mit den spezifischen Entwurfsmitteln „Modelling Tape“ und „Modelling Clay“ sollen Einzelraum-Architekturen entwickelt werden. In Anlehnung an die architektonische Zeichnung - Grundriss, Ansicht, Schnitt - werden wir das „Modelling Tape“ als händische Planzeichnung nutzen. Der „Modelling Clay“ ist auch als Industrieplastilin bekannt. Er ist in seinem Ausgangszustand fest und verändert seine Modelliereigenschaft durch Erwärmen und Abkühlen.
Das Seminar vertieft und praktiziert die Handhabung beider Entwurfsverfahren und sensibilisiert das Thema der Formentwicklung einer Monocoque-Umhausung.
Im Zeitraum 23.04.25 – 26.04.25 ist eine Exkursion nach München beabsichtigt. Hierbei ist das Verkehrszentrum München als zentrales Exkursionsziel für das vor Ort Zeichnen und Fotografieren von Monocoque-Formen vorgesehen. Die Exkursion wird durch Referate zu thematisch verknüpfbaren künstlerischen und architektonischen Arbeiten ergänzt.
An der Verbindungstelle zwischen Europa und dem Nahen Osten wurde vor nahezu drei Jahrtausenden eine Stadt gegründet, die sich zur heutigen Metropole Istanbul entwickelte. Der Bosporus trennt hier Kontinente und Meere. Jedoch machen Brücken und Schiffsverkehr Istanbul seit jeher zum Transitraum. Neben Menschen und Waren, die hier übergeleitet werden, sind es auch diverse Weltauffassungen, Praktiken und Formensprachen, die an diesem Punkt zusammenfinden.
Ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Muster in Sehen, Denken und Handeln erfordert die Reflexion des Eigenen und Eigentlichen. Eine präzise Einordnung wiederum ermutigt Gewohntes in erweiterte Kontexte zu transformieren.
Während einer gemeinsamen Exkursion nach Istanbul analysieren wir solche Zusammenhänge, indem wir die Vielfalt des Orts beobachten.Wir werden Ornamentik und Fassadengestaltung, die Organisation von Einzelelementen/ oder -gebäuden sowie die Gefüge von Gebautem in den Fokus nehmen. Auf diese Weise erschließen wir uns Formen und Rhythmen der Stadt.
Die Beschäftigung mit dem Potential von Strukturen, als abstraktem Abbild eines Ausdrucks von Gegebenheiten, bildet den Schwerpunkt der Auseinandersetzung von „bridges and beats“.
Muster in der unmittelbaren Umgebung zu erkennen und diese zusammenzutragen, wird einer erster Schritt sein, um im Weiteren die Verknüpfung parallel vorhandener Strukturen zu suchen und damit einen Dialog unterschiedlicher Formensprachen zu eröffnen. Das Untersuchen der Pattern mittels Zeichnung und ergänzenden bildnerischen Techniken ermöglicht ein Ausloten von Transformationsmöglichkeiten und ein Weiterführen in räumliche Formationen. Die rhythmische Ordnung und das Spiel mit Variation und Verschiebung prägen sowohl inneres Gerüst als auch äußere Gestalt der Entwürfe. Das Raumgefüge entwickelt sich aus den Überlegungen zu der Rolle einer Form als Verbindungs- oder Überleitungsfigur.
Die Linie// Die Linie gilt als die Verbindung zweier Punkte bzw. beschreibt einen auseinandergezogenen Punkt mit den Merkmalen in der Länge und in der Richtung.
Die Fläche// Erscheint die Linie nicht allein, sondern befindet sich parallel mit einer oder weiteren Linien in selber Länge bzw. in selber Länge und Breite, so entsteht eine Fläche.
Der Raum// Erscheint zur Länge und Breite der Fläche noch die Tiefe als weitere Dimension sprechen wir vom Raum. - Die Fläche gewinnt an Form und wird zur räumlichen Erscheinung.
Die Linie ist ein gestalterischer Ursprung, die einer Idee die erste Skizze, die Form, ggf. auch den Raum geben kann. In diesem Seminar erforschen wir die Linie als Grundlage für die Entwicklung von Formen auf der Fläche sowie im räumlichen Kontext.
Thematisch werden wir uns mit den gestalterischen Grundformen (ausgehend von der Linie) im Verhältnis zu den Gesetzmäßigkeiten von Naturformen beschäftigen. Begriffe wie Wachstum, Vermehrung, Entwicklung,...geben den konzeptionellen Einstieg in der Auseinandersetzung.
Welche Ordnungsprinzipien lassen sich in der Natur sowie in der Gestaltung wiederfinden? Naturlinien und -formen zu beobachten, zu analysieren und die Möglichkeiten die eigene Wahrnehmung in unterschiedliche Techniken zu transportieren, wird der vergleichende Prozess des Seminars bilden.
Der Fokus wird dabei zunächst auf der Zeichnung und im Hochdruckverfahren des Linolschnitts liegen. Im nächsten Schritt wollen wir uns dem Tiefdruck (ital. Intaglio // zu dt.: gravieren oder stechen),der Technik der Kaltnadelradierung widmen.
Hervorzuheben die Wirkung und der Wechsel der dunklen Linie auf weißem Untergrund, die zu einer räumlichen Übersetzung mit/aus Draht und Stahlstäben weitergearbeitet wird.
Die Zeichen- und Druckarbeiten gelten als eigenständige Arbeit und auch als Entwurf für eine räumliche Arbeit. Wir arbeiten monochrom, schwarz und weiß, um Form und Umraum, zwei-oder dreidimensional, besser zur Geltung bringen zu können.
Die technische Be- und Verarbeitung des Werkstoffs Metall wird von Michael Preisack angeleitet und unterstützt.
Wintersemester 2024-25
Der Entwurf* thematisiert für eine zukünftige Raumnutzung durch den Menschen eine sparsamere Verwendung von Material und Raum.
Hierbei wird der nah umgebende Körperraum wie auch der Kollektivraum des Menschen als Mindestmaß der Umhausung untersucht. Wir beschäftigen uns mit reduzierten Raummaßen, welche uns aus dem Automobil und dem Mobiliar-Raum vertraut sind. In einem zweiten Schritt versuchen wir Körper- und Kollektivraumeinheiten einem Bestandsbau gegenüberzustellen.
Mit einer Exkursion nach Florenz untersuchen wir den intensiv thematisierten Raum des Menschen – einerseits in der Anatomie (La Specola) andererseits auf Basis der Geometrie. Das Stadtgebilde Florenz zeigt zudem als historisches und als modernes Beispiel (Stadtteil Sorgane) im städtischen Maßstab, Zusammenhänge von Architektur und Gesellschaft.
Als visionäres Forschen werden wir kleine Räume entwerfen und deren Formsprache von der menschlichen Figur ableiten. Den Körperräumen steht das Kollektive, der gemeinschaftlich genutzte Raum, gegenüber.
Die Veranstaltung wird durch Referate zu bisherigen Visionen von Raumnutzung, wie Galina Balashova, Frederick Kiesler aber auch Eduardo Chillida und Ana Mendieta es vorschlagen, ergänzt.
Ziel des Entwurfes ist mittels unterschiedlicher Materialien und Methoden räumliche Visionen zu Körperraum und Kollektiv zu entwickeln, die schließlich maßstäblich, räumlich umgesetzt werden. Hierbei ergänzen die Zeichnung, die Fotografie und die Collage die räumliche Übersetzung im Entwurf. Der Entwurf nimmt seinen Auftakt in Einführungsübungen.
Ein gemeinsam ausgemachter Bestandsraum, wird uns als Anhalt und Gegenüber dienen.
*(Der Entwurf ergänzt den Entwurf „Körperraum und Kollektiv“- 01 im WS 24/25)

